28 Grad, abends um 21 Uhr. Ich bin eigentlich nur noch müde von 12 Stunden Autofahrt. Wir sind in Lipljan angekommen. Der dritte Reisetag, 2000 Kilometer von zuhause entfernt.

Die Strecke führte uns über Österreich, Slowenien, Kroatien, Montenegro und Albanien bis in den Kosovo. Hier stehen wir jetzt in der Nachthitze in einer pulsierenden Stadt und warten auf einen albanischen Freund, dessen weitläufige Verwandtschaft uns eine Wohnung für die Zeit hier vermieten will. Wir haben nicht mehr als eine Telefonnummer, aber tatsächlich, nach einem kurzen Telefonat fährt ein Auto vor.
Wie und wo wir hinmüssen ist noch nicht so ganz klar, dafür wird jetzt eifrig telefoniert und nach und nach gesellen sich immer mehr Albaner zu uns auf den Parkplatz vor einem Supermarkt und telefonieren mit ihren Handys. Irgendjemand hat dann tatsächlich den Wohnungsschlüssel und weiß ebenfalls den Ort der Wohnung. Inzwischen sind wir von vermutlich 15 albanischen jungen Männern umringt.
Die Frage, wer das denn alles sei, wird mir mit „Familie“ beantwortet, um anschließend der albanischen Sippe vorgestellt zu werden. Ich staune und lerne: Hier sind fast alle miteinander verwandt. Das Grüßen von Frauen ist hier eher nicht gerne gesehen. Mrs. L trägt‘s mit Fassung, unsere erwachsene Tochter auch. Die Wohnung erweist sich als Privatwohnung in einem Hochhaus im fünften Stock. Was hätte ich sonst erwarten sollen? Das ist schließlich kein Touristengebiet hier, die einzigen Touristen sind Albaner oder Deutsche mit albanischen Wurzeln aus Deutschland, die hier in den Ferien ihre Familien besuchen.



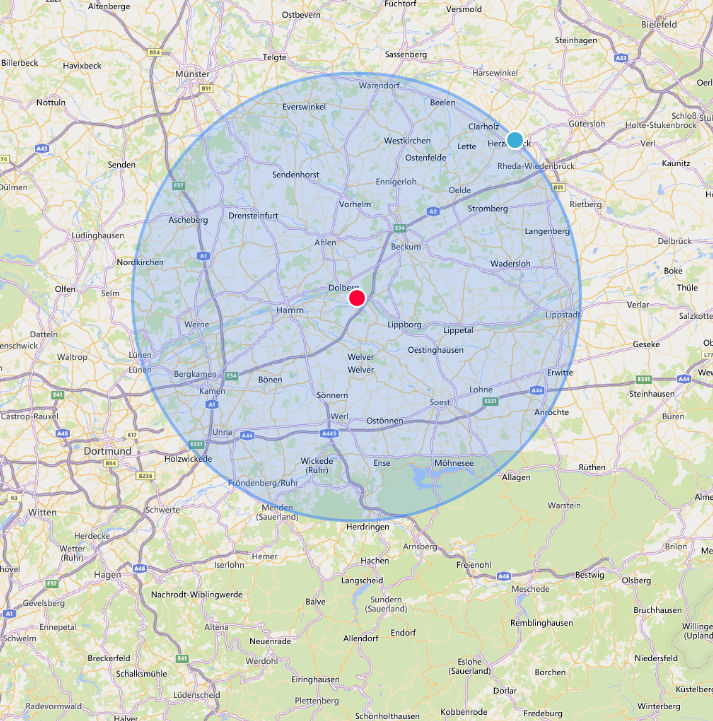
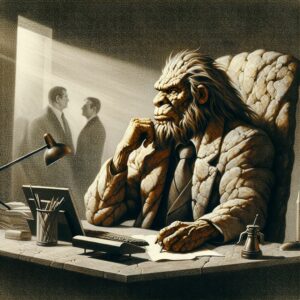 Eine
Eine 